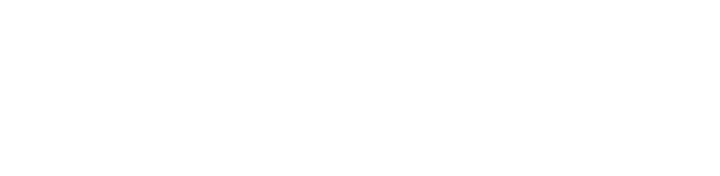Maggy bekam 1996 Typ-1-Diabetes, ihre Mutter 1998. Eine ungewöhnliche Konstellation … Wie die beiden damit zurechtkommen, erzählen sie im Interview.
Wenn man sich den Diabetes mit der Mutter teilen muss Es ist doch furchtbar, wenn die Mutter einem alles nachmachen muss. 1996 bekam ich die Diagnose und meine Mutter Martina folgte 1998. Plötzlich waren wir zu zweit oder dritt, wenn man unseren Diabetes als Familienmitglied betrachtet. Es gibt unterschiedliche Statistiken, die die Wahrscheinlichkeit von zwei Typ-1-Diabetikern in nahen Verwandtschaftsverhältnissen zwischen 6 und 12 Prozent anberaumen. Wir hatten auf jeden Fall den Jackpot gewonnen. Eine nicht immer ganz einfache Situation. Ich habe meine Mutter interviewt, wie sie das empfand, und komme auch selbst zu Wort. Ein Interview aus zwei Perspektiven Martina, wie war es für Dich, als Deine Tochter 1996 die Diagnose Diabetes bekam? Martina: Nun, zuerst einmal war ich schockiert, da ich durch einige Fälle in der Verwandtschaft die Krankheit (zumindest Typ 2) kannte. Da ich aber eine Kämpfernatur bin, habe ich die Krankheit sofort angenommen und mich informiert. Ich kaufte Bücher und fing an zu lesen, um den Feind genau kennenzulernen. Damals konnte man sich ja noch nicht über das Internet informieren. Wie habt Ihr euch nach der eigenen Diagnose gefühlt? Martina: Meine Diagnose steht im Zusammenhang mit einem persönlichen Schicksalsschlag. Es war in der Zeit nach der Trennung von meinem Ehemann. Neben der Scheidung kam dann auch noch der Diabetes dazu. Ich fand generell unsere Gene nicht mehr so „cool“, sondern eher etwas belastend. Maggy: Für mich war es tatsächlich eine Erleichterung. Ich war die sechs Monate vor der eigentlichen Diagnose immer wieder im Krankenhaus und beim Arzt. Ich hatte ständig wahnsinnige Magenkrämpfe – ein Symptom, dass mich bis heute bei hohen Blutzuckerwerten begleitet. Aber damals kam niemand auf die Diagnose, da ich übergewichtig war und der typische drastische Gewichtsverlust ausblieb. Deswegen diagnostizierte man auch erst einen Typ-2-Diabetes. Das hätte mich beinahe das Leben gekostet. Und wie war es für Dich, als Deine Mutter die Diagnose bekam? Maggy: Ich war 14, fast 15 Jahre alt und da neigt man dazu, erstens den eigenen Diabetes nicht zu akzeptieren und zweitens auch etwas dumme Gedanken zu haben. Als meine Mutter vom Arzt kam und mir in unserer Küche sagte, dass sie nun auch Diabetes habe, dachte ich nur: „Gott sei Dank, jetzt lässt sie mich mit dem Scheiß in Ruhe! Jetzt hat sie ihren eigenen!“ Ich bin nicht stolz drauf, dass ich das gedacht habe. Es war für mich generell eine furchtbare Zeit, da es mir durch die Fehlbehandlung immer schlechter ging, egal wie viel Mühe ich mir gab. Martina, war es für Dich vielleicht sogar von Vorteil, dass Du den Diabetes bereits kanntest? Martina: Ja, in jedem Fall. Ich habe von einer Minute zur anderen die Krankheit bei mir angenommen und nach einer Kurzeinweisung vom Arzt auch gerechnet und gespritzt. Ich habe nicht mehr viel darüber nachgedacht, sondern einfach gehandelt. Natürlich waren mir die Konsequenzen klar. Und ich habe mir auch irgendwann die Zeit genommen, über die Zukunft nachzudenken. Aber es hat mich nicht sonderlich belastet. Nervt es Dich manchmal, dass Deine Tochter über Deine Erkrankung so gut informiert ist? Martina: Nein, eigentlich nicht. Ich höre mir alles an, weil ich ja meistens gar nicht die Zeit habe, diese Informationen selber zu erlesen. Deshalb bin ich dankbar, wenn ich etwas Neues oder Interessantes höre. Was war das schlimmste Erlebnis, was Ihr bezogen auf den Diabetes der anderen jemals hattet? Martina: Ich habe eigentlich immer Angst um meine Tochter, was ja auch völlig normal ist. Da sie alleine lebt, neige ich da auch zum Kontrollieren. Die schlimmsten Erlebnisse sind immer, wenn ich sie nicht erreichen kann. Insbesondere, wenn sie wieder alleine in der Weltgeschichte rumturnt. Ich bin zwar auch unheimlich stolz auf sie, weil sie sich hart ihren Traumjob erarbeitet hat und der ihr viele Auslandsaufenthalte ermöglicht, aber ich mache mir eben auch viele Sorgen. Maggy: Meine Mutter hat die denkbar schlechteste Ausgangssituation: einen sehr stressigen Beruf und ein Zuckermonster, das Stress so gar nicht mag. Das hat leider auch schon zu Hypoglykämien geführt, bei denen Fremdhilfe nötig war. Die größten Schockmomente sind die, wenn mein Stiefvater anruft – das macht er wirklich selten, er ist eher der Nachrichtenschreiber-Typ. Es besteht dann, wenn seine Nummer im Display erscheint, eine 50/50-Chance, dass ihm einfach nur nach Anrufen war oder meine Mutter eine schwere Hypo hatte. Glaubt Ihr, dass der Diabetes Eure Beziehung beeinflusst hat?
Martina: Ja, in jedem Fall, es ist ja das gleiche Schicksal, mit dem wir fertig werden müssen. Und es ist ja auch ein zentrales Thema in unseren Gesprächen. Der treue Begleiter sozusagen.
Maggy: Da ich erst ein Teenager war und dann später erwachsen wurde, hat sich ja generell etwas geändert. Auch in Bezug auf den Diabetes. Früher war sie eben die Mutter, die sich sorgte und die Regeln vorgab. Heute diskutieren wir auf Augenhöhe über dieses Thema. Aber manchmal, eben wenn meine Mutter wieder eine schwere Hypo hatte, dann verkehren sich die Rollen auch und ich bin plötzlich diejenige, die sich Sorgen macht, die sich kümmert.
Was würdet Ihr der anderen in Bezug auf den Diabetes wünschen?
Maggy: Ein sehr großer Wunsch ist gerade in Erfüllung gegangen: die Genehmigung für die neue Pumpe samt CGM. Meine Mutter rief mich sofort an und wir jubelten beide am Telefon. Das war ein toller Moment, und ich hoffe nun, dass die neue Pumpe und das CGM ihr helfen, alles besser in den Griff zu bekommen.
Martina: Ich wünsche ihr, dass sie immer weiter so tolle Werte hat und nicht die Folgekrankheiten bekommt, wie ich sie jetzt habe. Und dass ihr der Diabetes nie im Weg steht bei allem, was sie noch für ihr Leben plant.
Glaubt Ihr, dass der Diabetes Eure Beziehung beeinflusst hat?
Martina: Ja, in jedem Fall, es ist ja das gleiche Schicksal, mit dem wir fertig werden müssen. Und es ist ja auch ein zentrales Thema in unseren Gesprächen. Der treue Begleiter sozusagen.
Maggy: Da ich erst ein Teenager war und dann später erwachsen wurde, hat sich ja generell etwas geändert. Auch in Bezug auf den Diabetes. Früher war sie eben die Mutter, die sich sorgte und die Regeln vorgab. Heute diskutieren wir auf Augenhöhe über dieses Thema. Aber manchmal, eben wenn meine Mutter wieder eine schwere Hypo hatte, dann verkehren sich die Rollen auch und ich bin plötzlich diejenige, die sich Sorgen macht, die sich kümmert.
Was würdet Ihr der anderen in Bezug auf den Diabetes wünschen?
Maggy: Ein sehr großer Wunsch ist gerade in Erfüllung gegangen: die Genehmigung für die neue Pumpe samt CGM. Meine Mutter rief mich sofort an und wir jubelten beide am Telefon. Das war ein toller Moment, und ich hoffe nun, dass die neue Pumpe und das CGM ihr helfen, alles besser in den Griff zu bekommen.
Martina: Ich wünsche ihr, dass sie immer weiter so tolle Werte hat und nicht die Folgekrankheiten bekommt, wie ich sie jetzt habe. Und dass ihr der Diabetes nie im Weg steht bei allem, was sie noch für ihr Leben plant.