Der weltberühmte Komponist Johann Sebastian Bach (1685–1750) hatte vermutlich Diabetes und starb letztlich an einem Schlaganfall. Der Diabetes war aber nicht die einzige Bürde, die Bach begleitete: Sein Leben hielt viele schwere Schicksalsschläge bereit. Dennoch bewahrte er sich bis zum Schluss Zuversicht und eine ungeheure Schaffenskraft. Die Frage ist nur: Wie gelang ihm das? Antje weiß mehr.
Kennt ihr das? Wenn ich höre, dass dieser oder jener Prominente Diabetes hat, dann möchte ich auf einmal alles darüber erfahren – auch wenn mich sein Leben bislang überhaupt nicht groß interessiert hat. So ging es mir auch bei der DDG-Herbsttagung im November 2016 in Nürnberg, als bei der Eröffnungsveranstaltung der Psychiater Prof. Peer Abilgaard aus Duisburg über den Umgang von Johann Sebastian Bach mit seinem Typ-2-Diabetes sprach. Wenn man sich Bilder von Johann Sebastian Bach anschaut, die ihn in der Regel mit… nun ja… etwas kräftigerer Statur zeigen, dann wundert einen eigentlich nicht, dass er vermutlich mit genau den gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, die Übergewichtigen auch heute zusetzen: Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen. Tatsächlich geht die Wissenschaft heute davon aus, dass Bach alles andere als gesund war. Er litt wahrscheinlich unter einem nicht entdeckten Typ-2-Diabetes, durch den er kurz vor seinem Tod auch erblindete. Als Todesursache vermutet man einen Schlaganfall, dem möglicherweise bereits einmal ein weiterer Schlaganfall vorausgegangen war.Tod der ersten Ehefrau, 10 von 20 Kindern selbst begraben
Doch auch abseits von seinen verschiedenen gesundheitlichen Problemen musste der Komponist im Laufe seines Lebens schwere Schicksalsschläge und Belastungen hinnehmen. „Bach war mit zehn Jahren Vollwaise und mit zwölf Jahren nach dem Tod seines Onkels dann ganz auf sich allein gestellt“, berichtete Prof. Abilgaard. „Als seine erste Ehefrau starb, war er gerade auf Konzertreise. Sie war bereits seit vier Wochen beerdigt, als er zurückkehrte.“ Bach heiratete ein zweites Mal, mit seinen beiden Ehefrauen hatte er insgesamt 20 Kinder. „Von diesen 20 Kindern musste er zehn selbst begraben – all das war auch Ende des 17. Jahrhunderts hart!“, sagte der Psychiater. Daneben seine körperlichen Erkrankungen, außerdem über lange Zeit mangelnde Anerkennung für seine Arbeit. „Trotzdem hatte Bach den Ehrgeiz, jeden Sonntag im Gottesdienst eine frisch komponierte Kantate zu präsentieren. Er war also unglaublich resilient, wie man heute sagt“, erklärte Prof. Abilgaard. „Doch was war sein Überlebenskonzept? Woher rührt seine Schaffenskraft?“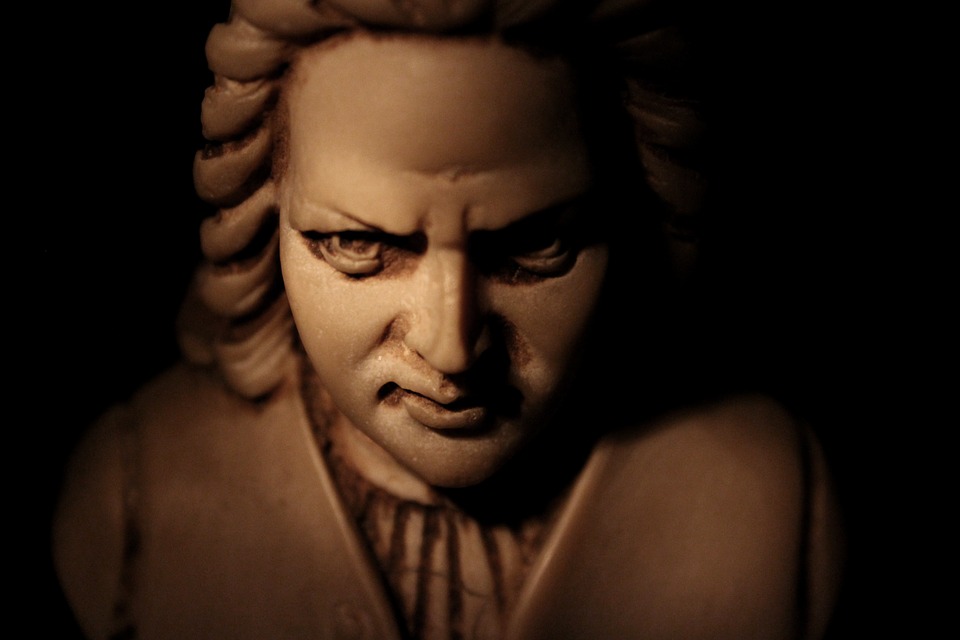
Bach war, wie man heute sagt, äußerst resilient
Wenn Leid also eine „gesetzte Größe“ ist, wie kann man mit diesem Leid besser umgehen? Wie kann man, neudeutsch gesagt, Resilienz entwickeln? Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky und die Entwicklungspsychologin Emmy Werner gelten als die Begründer des Konzepts der Resilienz und der „Salutogenese“ (zu Deutsch: Entstehung und Aufrechterhaltung von gesunden Situationen und Menschen). Zur Überlebenskunst gehören demnach- Humor
- dem Schmerz eine Stimme geben
- Hoffnung vermitteln
- Akzeptanz fördern
- Optimismus
- Wissen und Intelligenz
- Vielstimmigkeit
- Freundschaft, Begegnung und Freunde
- kulturelle bzw. spirituelle oder religiöse Stabilität
Tochter liebt Kaffee über alle Maßen – Vater nimmt’s mit Humor
Seinen Humor bewies Bach zum Beispiel mit seiner berühmten „Kaffeekantate“ (Bachwerkeverzeichnis BMV 211), zu der ihn wohl seine Tochter inspirierte, die leidenschaftlich gern Kaffee trank, obwohl ihr Vater dies nicht guthieß. Tochter Liesgen war schließlich bereit, auf den Genuss des geliebten „Schälchen Coffee“ zu verzichten, wenn sie statt dessen heiraten durfte. Allerdings beschloss sie, jeden Heiratsanwärter abzuweisen, der ihr den Kaffeegenuss verbieten wollte. Ihren Vater scheint das letztlich mehr amüsiert als geärgert zu haben, wenn man sich den Text der Kantate anschaut: “Ei! wie schmeckt der Coffee süße, Lieblicher als tausend Küsse, Milder als Muskatenwein. Coffee, Coffee muß ich haben, Und wenn jemand mich will laben, Ach, so schenkt mir Coffee ein!”Dem Schmerz, aber auch der Hoffnung eine Stimme geben
Doch Bach hatte natürlich auch seine düsteren Momente, die man ebenfalls in seiner Musik wiederfindet. Ich muss gestehen, dass ich sofort einen Kloß im Hals verspürte, als Prof. Abilgaard die Arie „Es ist genug“ (BWV 60) einspielte, die Bach komponierte, kurz nachdem seine kleine Tochter gestorben war. Nun habe ich zum Glück noch kein Kind zu Grabe tragen müssen, aber ich kenne natürlich mutlose Momente, in denen mir alles einfach zu viel ist und zu denen der Diabetes gern einen ordentlichen Teil beiträgt. Ja, Bach war ganz sicher in der Lage, seinem Schmerz eine Stimme zu geben. Ebenso gelang es ihm, Hoffnung zu vermitteln, wie Prof. Abilgaard uns mit dem Choral „In expecto“ aus der h-Moll-Messe (BWV 232) verdeutlichte. Er fängt ganz leise, bedrückt und getragen an und steigert sich dann in ein fulminantes und stimmgewaltiges Finale, das einem beinahe bildlich vor Augen führt, wie Bach die zahlreichen düsteren Momente seines Lebens überwand und Hoffnung schöpfte.


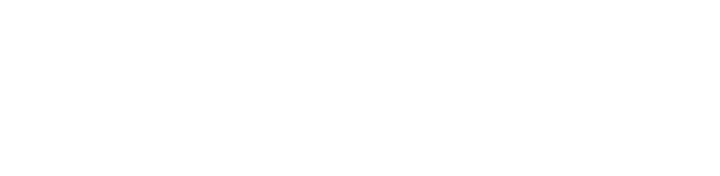
Das ist ein sehr schön formulierter und höchst informativer Beitrag. Vielen Dank !
Vielen Dank für diesen schön geschriebenen guten Artikel. Meine Spiegelneuronen lassen grüßen!