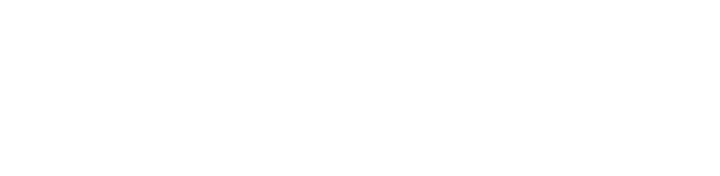Jasmin ist im September mit mehreren Koffern voller gespendeter Diabetes-Hilfsmittel in das Moria-Camp nach Lesbos gereist. Ihre Erfahrungen und Gespräche vor Ort hat sie für euch festgehalten.
„Entweder ich wäre auf der Flucht gestorben, oder eben durch eine Bombe in meinem eigenen Bett zu Hause.“ Diese Aussage begleitet mich seit Ende September jeden einzelnen Tag, ich stehe mit ihr auf und nutze sie, um mir bewusst zu machen, welch ein Privileg ich doch habe.
Diesen Satz sagte mir Naira auf Lesbos. Sie ist vor rund drei Jahren mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn aus Afghanistan geflohen. Als Grund nennt sie die Taliban und senkt dabei ihren Blick. Sie möchte nicht weiter darauf eingehen.
Nairas Geschichte
Zunächst sind sie in die Türkei geflüchtet, um von dort aus mit einem Schlauchboot nach Lesbos zu gelangen. Sie hatten viel Glück, betont Naira immer und immer wieder. Sie begründet dies, weil sie noch leben, nicht im Gefängnis waren und noch nicht verhungert sind. Jedoch gibt es einen Aspekt, den Naira immer auslässt, vielleicht auch, weil sie nichts daran ändern kann.

Naira ist Typ-1-Diabetikerin, die Diagnose, erzählt sie, hat sie als Jugendliche bekommen. Auch das war ein Grund ihrer Flucht, denn auf die medizinische Versorgung war leider kein Verlass mehr: Apotheken, Krankenhäuser und Ärzte waren regelmäßig Anschlägen oder Raubzügen ausgesetzt. Und doch war ihre Erkrankung gleichzeitig der Grund, warum Naira und ihre Familie immer wieder davon ablassen wollten zu fliehen. Es stand stets die Frage im Raum, wie Naira dies körperlich und medizinisch durchstehen solle.
Doch es gab einen Moment, erzählt Naira, da konnte es keine Zweifel mehr geben. Sie war mit ihrem Sohn auf dem, um Weg Essen für sich und ihre Familie zu besorgen, als sie plötzlich Schüsse hörte. Sie waren nah, sehr nah. Naira wird ganz still, schluckt und sagt: „Wenn man neben dir eine Mutter samt Kind erschießt, ist deine Heimat nicht mehr deine Heimat.“
Ich selbst kann kaum fassen, was sie mir da erzählt, fühle aber ihren Schmerz.
Auf der Flucht mit Diabetes
Dann wäre es sehr schnell gegangen, aber die letzten Jahre werden immer wieder von Lücken durchzogen, an manche Dinge will man sich auch einfach nicht erinnern, meint Naira.
Ihre Diabetes-Erkrankung ist natürlich präsent, aber seit drei Jahren hat Naira keinen wirklichen Überblick über ihren gesundheitlichen Status. Insulin und auch Blutzuckermessgerät mit passenden Teststreifen standen nicht immer ausreichend zur Verfügung, auch heute nicht hier auf Lesbos. Sie erklärt mir, dass sie Insulin, nur um zu überleben, injiziert hat. „Ich muss mir das Insulin seit drei Jahren genau einteilen und sehr viel schätzen, aber ich werde besser“, sie lächelt leicht. Doch die Realität ist lebensgefährlich, regelmäßig wird Naira in der Klinik von Mytilini, der Hauptstadt von Lesbos, behandelt. Wie viele Ketoazidosen sie schon hatte, kann sie nicht mehr zählen, aber sie berichtet, dass der Ablauf in der Klinik immer derselbe ist. Sie wird mit dem Rettungswagen eingeliefert, kommt an den Tropf, bis es ihr etwas besser geht, je nach diensthabendem Arzt bekommt sie Insulin und Teststreifen für ein paar Tage, Wochen oder Monate ausgehändigt.
Die ärztliche Versorgung auf Lesbos
Naira erzählt, dass die Verabschiedung, die nach spätestens zwölf Stunden stattfindet, wie ein „bis zum nächsten Mal“ ist, denn sie und das Krankenhauspersonal wissen: Man sieht sich wieder. Auch ich kann ihr mit meinem Mitbringsel nur eine begrenzte Zeit mit Kanülen, Insulin, Blutzuckertestutensilien und Traubenzucker aushelfen.

Naira ist auch nicht alleine mit ihrer Situation, in Kara Tepe (Moria 2.0) befinden sich rund 12.000 Menschen (Stand: 01.10.2020), darunter, schätzt man, befinden sich rund 150 Menschen mit Diabetes Typ 1.
Vor Ort ist es unheimlich schwer, mit betroffenen Menschen zu sprechen, der Zugang zum Camp wird mir bis auf einen kleinen Ausflug, samt Polizei-Eskorte, stets untersagt. Neben Naira habe ich noch die Chance, mit freiwilligen Helfern des Ärzte-ohne-Grenzen-Teams zu sprechen, sie sind dankbar für die mitgebrachten Spenden der Community, geben aber klar zu erkennen, dass sie völlig überlastet und überfordert sind. Die Menschen vor Ort können nur oberflächlich behandelt werden, akute Sachen gingen direkt in das örtliche Krankenhaus, von einer wirklich medizinischen Versorgung kann hier nicht die Rede sein.
Es fehlt an allem – an allen Ecken, die Insel Lesbos ist mit der Situation völlig überfordert, ebenso wie Griechenland als Land.
Meine Erfahrungen vor Ort
Aus meiner Sicht gehört dieser Ort, ebenso wie die restlichen Flüchtlingscamps Europas, verboten. Die Menschen sind auf die unwürdigste Art und Weise untergebracht, abgesehen davon, dass die Zelte nicht für alle Menschen ausreichen, das ehemalige Militärgelände voll gespickt ist mit alter Munition, Minen und Sprengkörpern, sind nicht einmal sanitäre Anlagen vorhanden, keine Duschen oder Toiletten.
Es ist kaum vorstellbar und es würde kein Wort der Welt beschreiben, was dort vor sich geht. Die Diabeteserkrankung von beispielsweise Naira ist da nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein und findet schon lange keine Priorität mehr in ihrem Leben, weil es schlichtweg nicht möglich ist.
Für mich persönlich war es eine harte Erkenntnis, dass mein Engagement, hier und vor Ort, nichts groß verändern wird. Es ist nicht sinnlos, aber nichts Weltbewegendes.
Heute, knapp drei Monate nach meinem Besuch, bin ich voll versorgt, mit Insulin, Sensoren, Essen, ja, einfach allem, was ich will. Mehr, als ich brauche. Und die Menschen auf Lesbos?!
Es hat sich nichts geändert, es sind weniger Menschen im Camp, mittlerweile noch rund 7.000, aber die Zustände sind immer noch menschenunwürdig.
Naira und ihre Familie harren weiter aus, sie warten darauf, Asyl beantragen zu können, sie würden gerne in Griechenland bleiben, dort ein Leben aufbauen, arbeiten gehen, ein Zuhause haben, denn egal wie schrecklich manche Tage im Camp sind, hier fallen keine Bomben.
Spenden für Ärzte ohne Grenzen
Wenn ihr möchtet, denkt doch einmal darüber nach, ob ihr bereit seid, für Menschen in Not, etwas zu spenden. Hier kommt ihr zum Spendenformular von Ärzte ohne Grenzen!
Über das Leben mit Typ-1-Diabetes in Krisengebieten hat auch Steffi ein Interview geführt: Das Leben mit Diabetes im krisengeschüttelten Venezuela