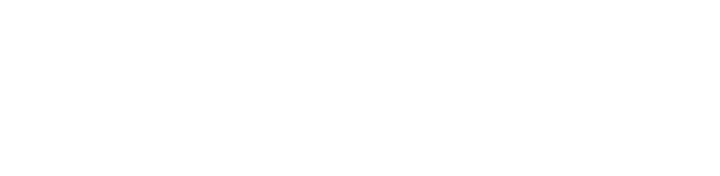„Ihr Kind wird im Laufe seines Lebens mit ziemlicher Sicherheit an Typ-1-Diabetes erkranken!“ Genau diesen Satz möchte man nicht hören, wenn man mit seinem Kind an einem der Früherkennungsprogramme teilnimmt. Trotzdem zahlt sich die frühzeitige Gewissheit auf lange Sicht aus, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Antje berichtet, was sie beim Kongress der Deutschen Diabetes Gesellschaft hierzu in Erfahrung gebracht hat.
Ich habe Typ-1-Diabetes, seit ich 40 Jahre alt bin. Ein untypisches Alter. Rein statistisch betrachtet hat mein Sohn ein Risiko von 3–5 Prozent, dass seine Bauchspeicheldrüse in Bezug auf die Insulinproduktion ebenfalls irgendwann einmal den Geist aufgibt. Als ich meine Diagnose erhalten habe, war er 15 Jahre alt, heute ist er 25. Hat er inzwischen ein geringeres Risiko, auch einen Typ-1-Diabetes zu entwickeln?
Eine Antwort auf diese Frage gäbe es nur, wenn mein Sohn an einem Früherkennungsprogramm teilnähme. Anfangs war ich noch skeptisch, ob mich bzw. uns ein mögliches positives Ergebnis nicht unnötig belasten würde. Mittlerweile befürworte ich das Screening. Doch inzwischen ist mein Sohn zu alt, um an der Früherkennungsuntersuchung des Helmholtz Zentrums München (A world without 1) teilzunehmen. Die Untersuchung richtet sich an Angehörige von Menschen mit Diabetes bis zu einem Alter von 21 Jahren.
Der Umgang mit statistischen Risiken ist immer schwierig
Für uns wird sich das Erkrankungsrisiko meines Sohnes also nicht genauer eingrenzen lassen. Doch alle teilnehmenden Familien können durch die Früherkennungsuntersuchung Gewissheit bekommen, ob ihr Kind Antikörper hat, die typisch sind für einen Typ-1-Diabetes und damit einen Typ-1-Diabetes höchstwahrscheinlich machen. Nun ist der Umgang mit statistischen Risiken immer schwierig. Und der Umgang mit dem Risiko, irgendwann einmal an einer chronischen Stoffwechselstörung zu erkranken, ist es erst recht. Deshalb beschäftigen sich Forscher schon seit einer ganzen Weile damit zu untersuchen, welche Auswirkungen die Erkenntnisse aus den Screening-Untersuchungen auf Frühstadien des Typ-1-Diabetes auf Familien haben. Beim diesjährigen Jahreskongress der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) präsentierte die Psychologin Prof. Karin Lange (Hannover) die neuesten Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet.

Man muss auch das genetische Risiko der Allgemeinbevölkerung betrachten
Statistisch betrachtet wird eines von 300 Neugeborenen im Laufe seines Lebens an Typ-1-Diabetes erkranken. In der Allgemeinbevölkerung ist dieses Risiko allerdings kaum bekannt, kaum jemandem bereitet es Sorgen. Anders sieht es aus, wenn die Eltern bereits Typ-1-Diabetes haben. Ist die Mutter betroffen, erhält eines von 25 Neugeborenen irgendwann im Leben die Diagnose Typ-1-Diabetes. Bei einem Vater mit Diabetes liegt die Chance sogar bei 1:16. Es ist bekannt, dass 90 Prozent der Menschen mit Typ-1-Diabetes keine Verwandten ersten Grades mit Typ-1-Diabetes haben. Doch unter den Menschen, die zwar keine Angehörigen mit Typ-1-Diabetes, aber ein erhöhtes Risiko haben, wird eins von zehn Neugeborenen im Laufe seines Lebens Typ-1-Diabetes bekommen. Für Prof. Lange ist deshalb klar, dass man das langfristige Ziel der Prävention von Typ-1-Diabetes nur dann erreichen kann, wenn man sich um das genetische Risiko in der Allgemeinbevölkerung kümmert. Und nicht nur bei den Familien, in denen bereits Typ-1-Diabetes vorgekommen ist.
Manche sind traurig über die verlorenen unbeschwerten Jahre
Wie die Psychologin berichtete, hat sich in den bisherigen Screening-Programmen auf Antikörper für Typ-1-Diabetes gezeigt, dass nur wenige Eltern mit einem positiven Testergebnis gerechnet hatten – und zwar, weil ein Elternteil selbst Typ-1-Diabetes hat. Für andere, bislang durch die Erkrankung völlig unbelastete Familien, hingegen kamen positive Testergebnisse aus heiterem Himmel. „Anfangs ist das ein großer Schock. Wir beobachten allerdings, dass die Familien zwölf Monate später fast alle sagen, dass das Testergebnis sie nicht mehr stark belastet“, sagte Prof. Lange. Manche Eltern seien traurig über die „verlorenen unbeschwerten Jahre“.

Auch die wiederholten Untersuchungen, Sorgen und Unsicherheit sowie die bislang unerfüllte Hoffnung auf Heilung könnten Eltern psychisch belasten. Dem stünden aber auch klare Vorteile des Screenings gegenüber: Familien mit positiv gescreenten Kindern pflegten meist einen gesünderen Lebensstil und würden von Beginn an qualifiziert auf die bevorstehende Diagnose vorbereitet. Ihre Eltern könnten dem Therapiestart entsprechend deutlich gelassener entgegenblicken. Ebenfalls nicht zu unterschätzen: Wenn ein Kind von kleinauf engmaschig kontrolliert und frühzeitig mit Insulin behandelt wird, kommt es bei der Manifestation nicht mehr zu lebensbedrohlichen Ketoazidosen.
Neue Studie aus Schweden zeigt positive Effekte des Screenings
Eine aktuelle Studie aus Schweden zeigt nun, dass sich all dies nicht nur positiv auf die Psyche der beteiligten Familien auswirkt, sondern auch auf die Qualität der Diabetestherapie. An der DiPiS-Studie nahmen 51 Kinder mit Typ-1-Diabetes teil, bei denen im Zuge eines Screening-Programms eine Vorstufe des Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurde und die eine entsprechende Vorbereitung durchlaufen hatten. Sie wurden mit 78 Kindern verglichen, bei denen die Diagnose erst aufgrund der üblichen Symptome gestellt wurde. Die Kinder waren im Schnitt 6,8 Jahre alt. Untersucht wurde, inwieweit sich die Früherkennung eines Prädiabetes auf Therapie, Insulinbedarf und HbA1c-Wert fünf Jahre nach der Manifestation auswirkte.
Deutlich bessere Stoffwechselkontrolle bei den gescreenten Kindern
Es zeigte sich, dass die gescreenten und geschulten Kinder über Jahre hinweg eine bessere Stoffwechseleinstellung, bessere HbA1c-Werte und eine höhere allgemeine Zufriedenheit aufwiesen als die Kinder, deren Risiko nicht im Rahmen der Früherkennung aufgefallen war. Die Studienautoren gehen davon aus, dass eine bessere Stoffwechselkontrolle gerade in den Anfangsjahren nach der Diagnose zu besseren Langzeitergebnissen und einem geringeren Risiko für Folgeerkrankungen beitragen kann. Prof. Lange betonte daher: „Das ist eine neue Erkenntnis. Früherkennung schadet nicht nur nicht, sondern verbessert auch die Therapie bei den Kindern, bei denen sich tatsächlich ein Typ-1-Diabetes manifestiert.“
Auch wenn es für mein eigenes Kind nun nicht mehr relevant ist, sind diese neuen Erkenntnisse für mich ein gewichtiges Argument dafür, an der Früherkennung auf Typ-1-Diabetes teilzunehmen. Wie seht ihr das?
Ob die eigene Diagnose im Kindes- oder Erwachsenenalter stattfand: Es ist immer ein einschneidendes Erlebnis. In unserem neuen Format Hey, Community! will Ramona eure Geschichten hören!